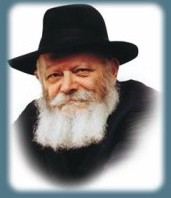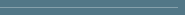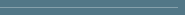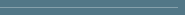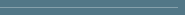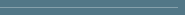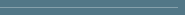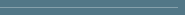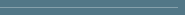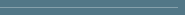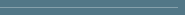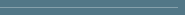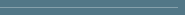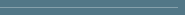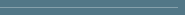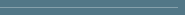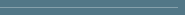| |
Gedanke der Woche, Purim:
Wollen Sie Ärger?
Er sah ihn kommen. Alle knieten nieder,
doch Mordechai blieb sitzen. Als Haman sich näherte,
begegneten sich ihre Blicke. Haman sah in Mordechais
Augen weder Wut noch Aufsässigkeit, nur die entschlossene
Ruhe eines Mannes, der weiß, wofür er eintritt
und auf wessen Seite er steht. In diesem Moment beschloss
Haman, Mordechai und sein Volk zu vernichten.
Haman war der persische Vizekönig, der mächtigste
Mann im mächtigsten Reich der Welt. Mordechai war
der Sprecher der Juden. Er „saß am Tor des
Königs“ und war einer der königlichen
Berater. Haman hatte beim König durchgesetzt, dass
alle Bürger sich vor dem Vizekönig verneigen
mussten. Mordechai weigerte sich. Warum? Er war doch
Realist und wusste, was ihn erwartete. Weshalb setzte
er alles aufs Spiel, nicht nur sein Leben und seinen
Rang, sondern auch das Leben aller anderen Juden?
Haman wollte wie ein Gott verehrt werden. Na und? Man
konnte sich ja verneigen und dann weitergehen. Ist es
nicht sinnlos, sich zu weigern und dafür sein Leben
und das Leben des ganzen Volkes zu opfern? Nun, genau
darum geht es. Manche Regeln hat G–tt in die Substanz
des Universums eingewoben und dadurch unverletzlich
gemacht. Wir dürfen sie niemals brechen, sonst
werden wir daran zerbrechen. Keine andere Macht als
G-tt anzuerkennen ist das höchste aller Gesetze,
und dagegen hätte Mordechai verstoßen, wenn
er sich vor Haman verbeugt hätte. Natürlich
hielt er Haman nicht für einen Gott - aber niemand
stellte ihm eine philosophische Frage; man verlangte
von ihm, etwas zu tun.
Würde er sich vor Haman verneigen und so das persische
Reich als die größte Macht in seinem Leben
anerkennen? Oder würde er Hamans Befehl missachten
und seine Rache heraufbeschwören, jedoch G-tt treu
bleiben? Für Mordechai war das keine Frage. Er
trennte seinen Glauben nicht von seinem Leben und seine
Grundsätze nicht von seinem Alltag. Er lebte, was
er glaubte, und er glaubte, was er lebte. Es gab keinen
Widerspruch.
Und das galt nicht nur für ihn. Alle Juden standen
hinter ihm. Selbst als Haman befahl, jeden Juden hinrichten
zu lassen, versteckten sie sich nicht. Im Gegenteil
– sie hielten an der Torah und ihren Geboten fest.
Ist das abstrakter Idealismus oder eine unpraktische
Haltung?
Nun, wir wollen sehen, wie es weiterging. Haman wurde
getötet, Mordechai übernahm sein Amt, und
anstatt von ihren Feinden umgebracht zu werden, töteten
die Juden alle, die sie vernichten wollten. Nicht schlecht
für Idealisten! Aber das war kein Idealismus, sondern
die Einsicht in die Realität unserer Existenz.
Diese Welt ist G-ttes Welt, und weil Mordechai und die
Juden daran festhielten, hatten sie Erfolg.
Der Standpunkt des Rebbe
Gedanken und Einsichten des Lubawitscher Rebbe
Was du erfahren kannst, ist nicht unendlich. Was
du spürst, kann nicht G–ttes Wesen sein. Offenbarungen
und Erscheinungen sind nicht das Höchste im Leben.
Das Höchste ist, wenn du einfach deine Pflicht tust.
Vielleicht empfindest du dabei nichts und hast nicht einmal
Zeit, dich zu fragen, ob du etwas empfindest. Aber du
bist eins mit G–ttes Wesen und Existenz, du bist
ein Strahl seines Lichts.
Fossano in Norditalien liegt am Fuße der Alpen
in der Nähe des Passes, der durch das Hochgebirge
zwischen Frankreich und Italien läuft. Im Frühling
des Jahres 5556 (1796) herrschten Unruhe und Krieg.
Frankreich wurde von der Revolution erschüttert,
und in Italien kämpften französische und
österreichische Heere gegeneinander.
Damals wurde ein 27-jähriger französischer
General namens Napoleon Bonaparte zum Oberbefehlshaber
der französischen Armee in Italien ernannt. Der
Vormarsch der Franzosen war ins Stocken geraten, und
der junge, energische Offizier sollte ihn wieder in
Gang bringen. Das gelang ihm auch, und unter seinem
Befehl errangen die Franzosen einen Sieg nach dem
anderen.
Kurz vor Pessach belagerten die Franzosen Fossano
und begannen die kleine Stadt zu bombardieren. Die
Bomben fielen fast täglich, richteten große
Schäden an und forderten viele Opfer. Aber die
Stadt kapitulierte nicht, obwohl ihre Lage düster
schien. Während der Belagerung kam Pessach, und
trotz aller Not waren die Juden der Stadt entschlossen,
ihr „Fest der Befreiung“ fröhlich
zu begehen.
Selbst in normalen Zeiten war Pessach eine Zeit der
Angst und Gefahr für die Juden, denn in der Osterzeit
nahm der Hass ihrer christlichen Nachbarn oft noch
zu, und sie wurden mit den wildesten Beschuldigungen
überhäuft. Der schlimmste und verrückteste
Vorwurf lautete, in den Mazen befände sich das
Blut von Christen. Jeder Vorwand, und sei er noch
so unsinnig, genügte, um den Mob gegen die wehrlosen
Juden aufzubringen. Es war daher kein Wunder, dass
die Juden in Fossano Angst hatten. Doch als Pessach
kam, feierten sie die beiden Seder-Abende und die
ersten Tage des Festes mit der üblichen Freude.
Das machte viele Einwohner der Stadt wütend.
Konnte es einen besseren Beweis dafür geben,
dass die Juden sich über den Erfolg des Feindes
freuten? Gerüchte verbreiteten sich bei den Christen,
wonach die Juden mit den Belagerern sympathisierten
und ihnen womöglich wichtige Hinweise gaben.
Die Ältesten der jüdischen Gemeinde spürten
die Gefahr und baten den Stadtrat um Schutz. Doch
der war mit der Verteidigung der Stadt beschäftigt
und konnte keine Soldaten abstellen, um das Getto
zu bewachen.
Am vierten Abend von Pessach eröffnete der Feind
das übliche brutale Feuer; diesmal aber noch
präziser. Zufällig fiel kaum eine Bombe
ins Judenviertel, eine lange, schmale Straße
in der Nähe der Stadtmauer. Die Bomben schienen
über das Getto zu fliegen und in die anderen
Teile der Stadt zu fallen. Jetzt fiel es den Hitzköpfen
leicht, den Pöbel gegen die „verräterischen“
Juden aufzuhetzen. Ein Sieg über die Franzosen
war undenkbar – nicht aber ein Sieg über
die wehrlosen Juden. Mit Waffen aller Art lief der
Mob ins Judenviertel. Dort gab es keinen Widerstand,
denn die Juden hatten ihre Häuser verlassen und
sich in die Synagoge geflüchtet, wo sie sich
verteidigen wollten, obwohl die Feinde ihnen weit
überlegen waren. Doch sie wussten, dass ihre
Lage aussichtslos war, und darum beteten sie um ein
Wunder, das sie vor einem Massaker retten sollte.
Inzwischen bahnte sich der Pöbel den Weg durchs
Getto, brach in Häuser und Geschäfte ein
und plünderte sie. Aber das genügte den
Randalierern nicht – sie dürsteten nach
jüdischem Blut, und sie näherten sich der
Synagoge immer mehr. Diese befand sich im ersten Stock
eines Gebäudes. Eine schmale Treppe führte
zu einem Vestibül und von dort in die Synagoge,
wo die Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinde
aneinander gekauert auf den unvermeidlichen Angriff
warteten.
Der Mob, wahnsinnig vor Wut, erreichte die Synagoge
und begann die Treppe hochzusteigen. Einige drangen
bereits ins Vestibül ein. Plötzlich krachte
es ohrenbetäubend. Eine Granate, von den Franzosen
blindlings abgefeuert, durchbrach die Wand der Synagoge
und landete im Vestibül, genau vor den entsetzten
Angreifern, die sich sofort umdrehten und hastig zurückzogen.
Viele verloren ihre Beute, als sie voller Furcht um
ihr Leben rannten.
Für die Juden von Fossano war es ein herrliches
Wunder, denn sie wurden genau in dem Augenblick gerettet,
als ihr Schicksal scheinbar besiegelt war. Die Bombe
im Vestibül richtete nur geringen Schaden an
– als wolle sie nur die Angreifer vertreiben
und die Juden retten. Bald danach nahmen die Franzosen
die Stadt ein, und die Juden waren außer Gefahr.
Die Ältesten der Gemeinde entschieden, dass die
Juden von Fossano künftig den vierten Tag von
Pessach als Tag der wundersamen Rettung durch den
Allm-chtigen feiern sollten. Das klaffende Loch, das
die Bombe in die Wand geschlagen hatte, wurde nicht
repariert. Man machte daraus ein Fenster und versah
es mit einer goldenen Inschrift, die auf Hebräisch
an das „Wunder der Bombe“ erinnerte.
|
|